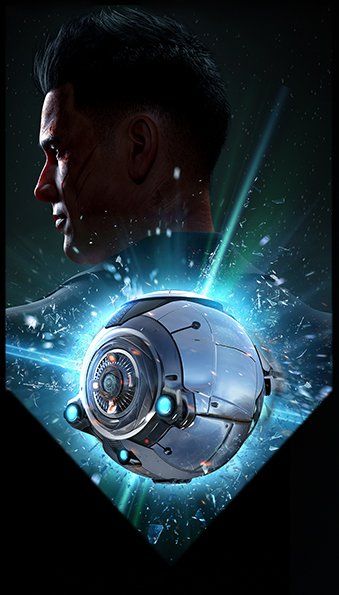Leseprobe
Anno 2019
1
Die Sonne schien erbarmungslos vom strahlend blauen Himmel und brannte auf John herunter. Seine Haut spannte, und selbst die kleine Lücke in seiner rechten Augenbraue schimmerte rötlich. Die Hitze war kaum noch auszuhalten. Noch mehr machte John aber die hohe Luftfeuchtigkeit zu schaffen, die ihm bereits bei seiner Ankunft in Malaysia das Gefühl gegeben hatte, gegen eine heiße Wand aus Wasserdampf zu laufen.
Kate und Konrad ging es nicht anders. Sie kauerten neben ihm und waren ebenfalls schwei߬gebadet.
Tags zuvor hatte er sich mit den beiden am Flughafen von Kuala Lumpur getroffen, um ein Labor unter die Lupe zu nehmen, auf das Konrad aufmerksam geworden war. Nicht das erste und vermutlich auch nicht das letzte, obwohl Konrad sich diesmal so sicher war, dass er die Nadel im Heuhaufen gefunden hatte, nach der sie bereits seit mehr als vier Jahren vergeblich suchten.
Dieser Erkenntnis folgend, hatte John irgendwann angefangen, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und die Suche nach ihrem Zielobjekt mit Ausflügen in die unberührte Natur zu verknüpfen. Das Protokoll stand dem nicht entgegen – ganz im Gegenteil. Er war sogar davon überzeugt, dass seine Exkursionen seiner Tarnung als Journalist, die er anfangs mehr schlecht als recht ausgefüllt hatte, entgegenkamen. Außerdem waren die ganzen Strapazen so besser zu ertragen, wenn er wieder einmal umsonst um die halbe Welt geflogen war.
Im Laufe der Jahre lernte er so fast alle Wunder kennen, die die Natur zu bieten hatte. Er hatte das Amazonas¬becken bereist, die Arktis und die Antarktis gesehen, sich durch den Kongo gekämpft und seinen Kopf in fast alle Weltmeere gesteckt, um nur einige seiner Ziele zu nennen.
Am meisten hatte ihn jedoch das Great Barrier Reef beeindruckt: ein Kunstwerk aus Milliarden von Korallen, das abertausenden von Fischen und Meeressäugern eine Zuflucht bot. So schön und faszinierend das Ganze war, so sehr schockierten ihn aber auch die Folgen des Klima¬wandels. Das Riff wirkte über Kilometer hinweg wie ausgestorben.
Und schuld daran war wie immer der Mensch, der die Verantwortung dafür trug, dass sich das Wasser um ein bis zwei Grad erwärmt hatte – nicht viel, aber genug um die verheerende und todbringende Korallenbleiche zu entfachen. Der Ge¬danke daran machte ihn jedes Mal wütend und traurig.
»Ich fühle mich wie eine ausgepresste Zi…«, beklagte sich Konrad, wurde aber jäh von Kate unterbrochen, als ein Jeep vor dem Gebäude hielt. Es war eines dieser flachen, in die Jahre gekommenen Häuser, wie sie am Rande des Urwaldes zuhauf die Landschaft ver¬schan-delten. An den Wänden prangte überall Graffiti, und das Dach sah so aus, als ob es den nächsten Sturm nicht überleben würde.
Die Graffitis wirkten auf John allesamt wie Geschmiere. Wilde Kompositionen aus Buchstaben und Zahlen, teils in Schwarz-Weiß und teils in Farbe, bis er mit seinem Blick an einem geradezu lebensecht wirkenden Abbild eines Orang-Utan hängen blieb. Wow, dachte John und war sofort fasziniert. Der Künstler hatte den Affen so an die Wand gemalt, dass man meinen konnte, der Orang-Utan baumelte mit einer Hand an der Regenrinne. Diese Geschöpfe muss ich mir unbedingt aus der Nähe ansehen, dachte John, bevor Kate seinen Gedanken ein Ende setzte.
»Ich glaube, es geht los«, sagte sie. »Ich zähle drei Personen. Zwei Männer und eine Frau. Und so wie es aussieht, ist auch der Chemiker dabei, auf den wir gewartet haben.«
»Dann los«, erwiderte John und tippe mit dem Zeige-finger seiner rechten Hand an seine Uhr. Konrad und Kate machten es ihm nach und warteten, bis er anfing zu zählen.
Bei »drei« starteten sie gemeinsam den Countdown und schlichen auf das zugewucherte Gebäude zu, das als Teil eines alten Industriegeländes mit dem Dschungel zu verwachsen schien. John strebte dem Eingang entgegen, Kate schlich an der rechten Hausseite entlang und Konrad, wie abgesprochen, auf den Hintereingang zu.
Am Ziel angekommen, präparierten sie die verschie-denen Zugänge mit kleinen Sprengladungen und suchten seitlich der Türen Schutz. John kauerte rechts vom Haupteingang und schaute dabei auf seine Uhr.
Drei, zwei, eins, zählte er im Geiste mit und drückte bei »null« auf den Auslöser, genauso wie es auch Konrad und Kate taten. Mehr oder weniger gleichzeitig krachte und schepperte es. Die Explosionen waren nicht groß, aber groß genug, um die Türen aus den Angeln zu heben.
Dann drangen sie auch schon von drei Seiten in das Gebäude ein, jeder von ihnen mit einer Waffe im An-schlag.
Kate, eigentlich Jekaterina, hatte sich zuvor einen Mülleimerdeckel geschnappt und wie einen Schild vor sich hergetragen. Sie hatte spontan zugegriffen, nachdem sie realisiert hatte, dass sie ihre Gegner vermutlich vor den beiden anderen erreichen würde. So kam es dann auch.
Sie stürmte in den Raum und schrie »Hände hoch«, kassierte als Antwort aber eine Kugel, die ihr proviso-risches Schild fast durchschlagen hätte. Ihre Eingebung hatte ihr tatsächlich das Leben gerettet! Ohne zu zögern schoss sie zurück und traf den kleinen Malaysier in die Schulter. Und damit genau dort, wo sie ihn treffen wollte.
Der Kerl schrie auf und ließ sofort die Waffe fallen, während die beiden anderen die Hände hoben. Als Konrad und John herangeeilt kamen, war der Spuk bereits vorbei.
»Nett, dass ihr auch mal vorbeischaut«, begrüßte Kate keck ihre beiden Mitstreiter und setzte ein spöttisches Lächeln auf, das John und Konrad mit einem Grinsen quittierten. Die beiden waren mit ihrem Hang zur Ironie vertraut.
»Schöner Schild«, antworte Konrad und zeigte auf den Mülleimerdeckel, den Kate immer noch in der Hand hielt. »Das Ding steht dir wirklich gut und passt zu deinem Look.«
»Danke«, erwiderte sie und machte einen Knicks. »Das Ding, wie du es nennst, hat mir übrigens gerade das Leben gerettet.« Kate war natürlich klar, dass Konrad sie ebenfalls nur veräppeln wollte, weil er damit auf ihr Erscheinungsbild anspielte, das sich im Laufe der Jahre stark verändert hatte. Sie sah mittlerweile aus wie ein Punk. Sie trug die eine Seite ihrer rotgefärbten Haare kurz, die andere lang, und hatte jede Menge Piercings. Und noch dazu ein halbes Dutzend Ohrringe, die sie um ihre rechte Ohrmuschel drapiert hatte.
»Oh, wirklich?«, antwortete Konrad und bereute bereits, dass er sich diesen kleinen Scherz erlaubt hatte. Außerdem ärgerte er sich jetzt insgeheim darüber, dass er Kate offensichtlich die Flanke überlassen hatte, die eigentlich die seine hätte sein sollen. Schließlich war er der Soldat mit der meisten Kampferfahrung im Team. Sein Körper war der beste Beweis. Er war mit Narben über¬säht und seine Nase war nach den vielen Frakturen nie wieder richtig zusammengewachsen.
»Das reicht jetzt«, sagte John und schüttelte den Kopf. »Macht euch lieber nützlich und fesselt unsere drei Gastgeber!«
John selbst sicherte die Stellung, als Kate und Konrad seinen Befehl ausführten. Er dachte darüber nach, ob sie bei ihrem nächsten Einsatz Schutz¬westen tragen sollten. Sofern es denn einen nächsten Einsatz geben würde. Allerdings sprach leider alles dafür, so wie es hier aussah. Sie würden wohl wieder nicht fündig werden.
Als Nächstes machten sie sich über die Ampullen her, die die drei Asiaten mitgebracht hatten und die jetzt in dem verdreckten Labor überall herumstanden.
»Was ist da drin?«, fragte Kate schroff und sah dabei den Mann an, den sie zuvor als Chemiker ausgemacht hatten. Sie war die Expertin für solche Fragen.
»MDMA«, antwortete der Kerl in feinstem Englisch.
»Liquid Ecstasy«, übersetzte Kate das eben Gesagte.
»Na super«, antwortete Konrad und trat vor Wut den Mülleimerdeckel durch die Gegend, den Kate zwischen-zeitlich abgelegt hatte.
»Glaubst du ihm?«, fragte John und blickte zu Kate herüber. Er wollte in jedem Fall sichergehen, dass sie nicht gerade verarscht wurden. Es wäre schließlich nicht das erste Mal gewesen, dass man versuchte, sie in einer vergleichbaren Situation hinters Licht zu führen. Drogenköche neigten von Natur aus zur Unehrlichkeit.
»Ja«, antwortete Kate, »ich mache zur Kontrolle aber noch einen Schnelltest.« Dazu lief sie nach draußen und holte einen kleinen Koffer aus dem Wagen, den sie gut versteckt hinter einem der anderen Gebäude geparkt hatten.
In der Zwischenzeit packten John und Konrad das ganze Zeug auf einen Haufen und traten die Ampullen kaputt, während die drei Gefesselten lautstark protes-tierten. Aber nur so lange, bis Konrad dem Erstbesten eine Schelle verpasst hatte.
»Sie sagen die Wahrheit«, bestätigte Kate ihre Annahme. »Es ist wirklich MDMA, auch wenn ich mir etwas anderes gewünscht hätte.«
Daraufhin machten John und Konrad die drei Gift-mischer los und zerrten sie nach draußen.
»Haut bloß ab«, sagte John, »und lasst euch hier nie wieder blicken, sonst kommt ihr nicht mehr so glimpflich davon.«
»Und hört auf, so ein dreckiges Zeug zu brauen! Euer Scheißzeug ist gefährlich«, rief Kate den dreien noch hinterher. »Sonst sehen wir uns wieder.«
»Vielleicht haben wir nächstes Mal mehr Glück«, sagte John am gleichen Abend, nachdem sie es sich – frisch geduscht – in der Bar ihres Hotels gemütlich gemacht hatten. Sie saßen in der dunkelsten Ecke und versanken fast in den weichen Ledersesseln, die um einen runden Tisch verteilt waren.
»Ja, vielleicht«, antwortete Kate, ohne die Frus¬tration in ihrer Stimme zu verbergen. Sie schien enttäuscht, wie so oft.
»Der wievielte Einsatz war das jetzt eigentlich?«, wollte Konrad wissen, während er in seinem Moscow Mule herum¬rührte.
»Ich glaube, der zweiundzwanzigste«, antwortete John. »Genau weiß ich es aber nicht. Ich habe irgendwann auf¬ge¬hört zu zählen.«
»War’s das dann für heute?«, fragte Kate und blickte ihren Commander missmutig an.
»Ja, aber ich dachte, wir essen noch etwas zusammen.«
»Nee, keine Lust«, antwortete Kate. »Ich will los. Außer¬dem ist mir der Appetit vergangen.«
»Komm schon!«, schaltete Konrad sich ein. »Wir lassen es heute richtig krachen. Ich bezahle auch. Das Essen, die Drinks, einfach alles.«
»Das ist wirklich nett von dir«, antwortete sie und strich Konrad mit der Hand sanft über den Arm. »Aber darum geht es nicht und das weißt du auch.« Dann stand sie auf, verabschiedete sich von den beiden und verschwand.
»Na dann, gute Reise«, rief John ihr noch hinterher, ohne zu wissen, wo sie zu Hause war. So wie er auch nicht wusste, wo genau seine anderen Kameraden ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Auch dies war Teil ihres Regelwerks und diente ihrer eigenen Sicherheit. Aus dem gleichen Grund wusste er auch nicht, welche Nachnamen sie verwendeten.
Ihm war lediglich bekannt, dass sein Team auf allen Kontinenten vertreten war und jeder für sich ein möglichst unauffälliges Dasein führte. Sie kommu¬ni-zierten ausschließlich über das Darknet und benutzten einen speziellen Code, der es fast unmöglich machte, ihnen auf die Spur zu kommen.
John war ihr Anführer und koordinierte alle Einsätze. Ursprünglich hatte sein Team aus sechs Männern und zwei Frauen bestanden, von denen zwei bereits nach ihrer Ankunft als verschollen galten.
Drei seiner Agenten waren Experten auf unter-schiedlichen Wissensgebieten, der Rest hatte einen militärischen Hintergrund, wie auch Konrad, der in dieser Region seine Kreise zog.
John seufzte und blickte Kate noch lange nach, bis Konrad ihn aus seinen Gedanken riss.
»Also ich hab immer noch Hunger«, sagte er und griff demonstrativ zur Speisekarte. »Was hältst du von einem saftigen Steak mit Pommes und dazu eine schöne Flasche Rioja?«
»Klingt gut«, antwortete John, durchaus dankbar für Konrads kleinen Aufmunterungsversuch.
2
Zehn Tage später blickte John immer wieder aus dem Fenster der zweimotorigen Maschine. Der Himmel war wolkenlos und von einem klaren Blau. Die Propeller drehten sich unablässig, begleitet von einem Surren, das ihn auf eine merkwürdige Weise beruhigte.
Unter ihm lag der Regenwald Sumatras, dem er gerade einen spontanen Besuch abgestattet hatte. Er hatte den Abstecher gemacht, um Orang-Utans zu fotografieren, und tatsächlich auch das Glück gehabt, welche zu sehen.
Die Story für seinen Blog hatte er bereits im Kopf. Er wollte von den Menschenaffen erzählen, die ihn wie keine andere Spezies zuvor berührt hatten. Vielleicht lag dies aber auch an seinem Wissen um den Fortbestand dieser fantastischen Geschöpfe, die nicht mehr lange in freier Wildbahn anzutreffen sein würden. Ihr Lebensraum war einfach nicht mehr groß genug. Der Mensch hatte den Dschungel gerodet, um Ölpalmen anzupflanzen. Millionen von Ölpalmen. John konnte dies aus dem Flugzeug bereits sehen, denn der Urwald reichte längst nicht mehr bis an den Horizont. Und wie so häufig nistete sich eine allzu bekannte Traurigkeit in seinem Inneren ein.
In der Regel blieb er in der Region, in der sein Primärziel lag. Auch diesmal, denn Sumatra war nur einen Katzen¬sprung von Kuala Lumpur entfernt.
Wann immer möglich, legte er seinen Fokus auf die Ozeane und Regenwälder, die dieser Planet zu bieten hatte. Nur zu verständlich, weil er bis zu seinem 32. Lebensjahr weder einen Wald noch eines der Weltmeere erblickt hatte. Die Erklärung war so einfach wie simpel. Denn da, wo er herkam, gab es weder das eine noch das andere.
Irgendwann hatte er angefangen, über seine Naturerlebnisse zu schreiben. Zuerst um seine positiven wie auch negativen Emotionen besser verarbeiten zu können, später aber auch wegen des Zuspruchs, den er von seiner Leserschaft bekam. Offensichtlich gefiel den Besuchern seines Blogs die Art und Weise, wie er die Folgen des Klimawandels in seinen Geschichten auf-bereitete, ohne dabei als Ankläger aufzutreten.
Zwei Tage später betrat John völlig übermüdet sein viel zu großes Penthouse, das er zusammen mit einem großen schwarzen Schäferhund bewohnte, wenn er nicht gerade auf Reisen war und seinen Hund notgedrungen in einer Tierpension zurücklassen musste.
Er hatte Golan, wie er den Hund genannt hatte, kurz nach seiner Ankunft aus dem Tierheim geholt und seitdem fast jede freie Minute mit ihm verbracht. Es war wohl die Einsamkeit in dieser anfangs fremden Welt, die ihn zu einem Hundenarren gemacht hatte.
Seine Rückreise hatte ihn von Sumatra über Kuala Lumpur und weiter nach Dubai geführt, bevor er dann endlich gegen Mitternacht am Flughafen München gelandet war. Wäre er früher gelandet, hätte er sich wie immer noch einen Pott Kartoffeln gekocht. So aber wollte er nur noch ins Bett.
Und trotzdem war er am nächsten Morgen bereits wach, als der Wecker klingelte. Die Zeitver¬schiebung hatte ihn wieder einmal um den Schlaf gebracht. Ganze zwei Stunden hatte er die Decke seines dreißig Quadratmeter großen Schlafzimmers angestarrt und sich in seinen Erinnerungen verloren.
Wie so häufig dachte er an den Mars, der rück¬blick-end etwas Hypnotisches hatte. Allein die Erinnerung an das allgegenwärtige Rot war so intensiv, dass der Gedanke daran ihn von innen heraus erwärmte.
Weit von der Realität entfernt brauchte er deshalb auch eine Weile, bis er die Kraft aufbrachte, um aufzu-stehen.
»Komm schon«, sagte er, nein, befahl er sich und quälte sich aus seinem Bett. Doch wie so häufig schaffte er es nur bis auf die Bettkannte. Dort blieb er einfach sitzen und blickte lange durch den karg eingerichteten Raum. Sein Blick schweifte am Ankleideraum vorbei, bis er am Teleskop hängen blieb, das John durch die Terrassentür sehen konnte. Er mochte seine Wohnung und ganz beson¬ders die große Dachterrasse, auf der er in heißen Sommer¬nächten sogar schlafen konnte. Die frische Luft und der Blick auf die Sterne hatten es ihm angetan.
Dann endlich rappelte er sich auf und wechselte in sein Kinderzimmer. Und wie immer war er splitterfasernackt. Anders konnte er nicht schlafen, das war schon immer so gewesen. Selbst als Kind hatte er es gehasst, wenn ihn seine Mutter in einen Pyjama oder Overall gesteckt hatte.
Das Kinderzimmer war eigentlich ein Fitnessraum. Er nannte es bloß so, weil der Makler bei der Wohnungsbesichtigung vor mehr als vier Jahren es so genannt hatte. Das Zimmer war Johns Heiligtum. Er liebte den Raum, allein schon wegen der massiven Holzdielen, die dort verlegt waren. Holz hatte für ihn etwas Magisches.
Schnell sprang er in eine bequeme Hose und holte einen kleinen, unscheinbaren Würfel aus seinem Versteck. Dabei handelte es sich um einen kleinen Hohlraum, den er unter einer losen Diele in den Estrich hineingestemmt hatte. Der darin versteckte Quader war nicht größer als ein Apfel, metallisch glänzend und ohne jede Struktur.
So unscheinbar der Würfel auch war, umso erstaunlicher war dafür sein Innenleben, das frühere Genera¬tionen vermutlich als Flaschengeist bezeichnet hätten.
Sein Dschinn hörte auf den Namen Gibson und war eine Hommage an seinen ehemaligen Ausbilder, der ihn zu dem gemacht hatte, der er heute war.
Genau genommen war Gibson ein interaktives Hologramm und seit vielen Jahren sein Trainingspartner. Er hatte ihn damals, wie alle anderen Rekruten auch, zu Beginn seiner Ausbildung erhalten und seitdem fast täglich mit ihm trainiert. Das Hologramm war das Produkt unzähliger feiner Lichtstrahlen, die je nach Bedarf und Geschmack zu jeder beliebigen Gestalt ineinander verschränkt werden konnten. Vorausgesetzt, man kannte die richtigen Wörter, um ihn aus dem Würfel hervorzulocken.
Nachdem John seine Muskeln gedehnt und sich warm gemacht hatte, stellte er den Würfel vor sich auf den Boden und sagte: »Gibson, Zeit fürs Training«, und sah zu, wie sich ein spindeldürrer und zugleich drahtiger Mann vor ihm materialisierte.
Gibson verbeugte sich und nahm eine Kampfposition ein, so wie es Krieger schon seit Jahrhunderten taten, wenn sie sich einem Gegner stellten. John tat es ihm gleich. Doch wieder einmal war er nicht schnell genug und kassierte den ersten Treffer, noch bevor er seine Hände vor die Brust genommen hatte. Es war nicht viel mehr als ein kleiner Klaps gegen sein linkes Ohr und nur ein Vorgeschmack auf das, was noch folgen sollte.
Den zweiten Treffer sah John ebenfalls nicht kommen. Er war zu sehr damit beschäftigt, Gibsons Fäuste abzuwehren, die wie ein Trommelfeuer auf ihn niederprasselten, als Gibson ihm sein Knie in die Rippen rammte. Ein Thai-Boxer hätte es nicht besser hin¬be-kommen.
Treffer Nummer drei war dann beinahe schon spektakulär. Gibson wich Johns Konter aus und sprang anschließend mühelos zur Seite, um ihn mit einem gezielten tiefen Tritt von den Beinen zu holen.
»Zeig doch endlich einmal, was du in all den Jahren von mir gelernt hast«, spöttelte Gibson.
»Sehr witzig«, antwortete John mit schmerzverzerrter Stimme. »Ich glaube, ich muss mal deine Program¬mierung ändern. Du wirst mir langsam zu frech.«
Das Training dauerte insgesamt zwanzig Minuten und ver¬langte John wie immer alles ab. Am Ende hatte er achtzehn Treffer kassiert, während Gibson nur zwölfmal getroffen worden war. Im Unterschied zu Gibson spürte er jedoch jeden einzelnen Treffer. Sie ähnelten kleinen Stromschlägen und wurden von Treffer zu Treffer schmerzvoller. Doch das Gute daran war, dass er jetzt hellwach und voller Adrenalin war. Von seinem Jetlag war nichts mehr zu spüren.
Dann war er auch schon mit einem Bein unter der Dusche. Das heiße Wasser wirkte wohltuend, und er genoss den Moment, bis sein Blick auf seine Uhr fiel, und er realisierte, dass es Zeit für die Arbeit war. Schnell trocknete er sich ab, verharrte dann aber in der Bewegung, als er sich selbst im Spiegel sah.
Ich sehe müde und alt aus, dachte er. Er konnte sogar einige graue Strähnen zwischen seinen dunkel¬blon¬den Haaren hindurchblitzen sehen, obwohl er noch keine vierzig war. Nur sein durchtrainierter Körper und seine Narbe hatten sich nicht verändert. Letztere spaltete seine rechte Augenbraue in zwei Teile und gab seinem Äußeren eine verwegene Note – ein Andenken an eine Aus¬ei¬nan¬der¬setzung während seiner Zeit als Mars-Defender. Doch all das war lange her.
Frisch geduscht fläzte er sich in schwarzer Jeans und T Shirt vor seinen Schreibtisch und checkte seine Nach-richten, bevor er sich in aller Ruhe einem Artikel widmete, den er heute unbedingt noch fertigstellen wollte. Der Artikel drehte sich um die Klimasünden der Kreuzfahrtschiffe, die mittlerweile zu hunderten über die Weltmeere schipperten. Denn so schön sich auf diesen Dingern Urlaub machen ließ, so fies war gleichzeitig ihr Schadstoffausstoß.
Umso mehr ärgerte er sich darüber, dass sich niemand dafür zu interessieren schien, dass die Ozeandampfer Schweröl auf See verfeuerten; eine dreckige schwarze Pampe, die Feinstaub und Schwefeldioxid hinterließ, als ob es kein Morgen geben würde.
Zu seinem Leidwesen kam er mit dem Artikel nur langsam voran. Er musste immer wieder daran denken, wie ignorant die Menschen dieser Generation dem Klimawandel doch gegenüberstanden, obwohl die Wetter¬phänomene und Naturkatastrophen schon lange nicht mehr zu übersehen waren.
Aber offensichtlich schienen Starkregen-Perioden, Überschwemmungen, Dürren, Orkane, Feuersbrünste und das Schmelzen der Polkappen niemanden ernsthaft zu interessieren. Es schien das Normalste der Welt zu sein, ganz so, als ob es das schon immer gegeben hätte. Vermutlich war die Menschheit aber einfach nur zu abgestumpft oder zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um die Tragweite ihrer eigenen Ignoranz zu erkennen, bis es zu spät sein wird und die Folgen des Klimawandels nicht mehr umgekehrt werden können. Dumm nur, dass der Point of no Return nicht etwa in weit entfernter Zukunft lag, sondern bereits in Sichtweite rückte.
Das ist schon irgendwie tragisch, dachte John. Die Menschheit im 21. Jahrhundert kennt alle Fakten, zieht aber leider die falschen Schlüsse. Es juckte John deshalb regelmäßig in den Fingern, die Wahrheit im Netz zu verbreiten und der Welt mitzuteilen, dass ihre Kinder und Kindeskinder am Arsch waren. Doch jedes Mal besann er sich eines Besseren. Nicht zuletzt, weil ihm kaum jemand glauben würde, dass die Erde unheilbar erkrankt war – infiziert vom Virus Mensch. Und dass der Exodus nicht mehr abgewendet werden konnte. Bestenfalls hätte man ihn einfach nur belächelt und schlimmstenfalls als Apokalyptiker abge¬stempelt.
Es war schon irre! Während der Dieselskandal die Nachrichten dominierte, wollte man die vielen anderen Ursachen des Klimawandels nicht sehen.
Am meisten ärgerte er sich über den systematischen Kahlschlag der Wälder. Es war doch ein Wahnsinn, dass jeden Tag weltweit rund vierhundert Quadratkilometer Regen¬wald abgeholzt oder abgebrannt wurden, ohne dass die Öffentlichkeit davon überhaupt noch Notiz nahm: unglaub¬liche 42 Fußballfelder pro Minute! Mehr als ein¬mal hatte John sich gefragt, wie bescheuert man sein musste, dem Planeten, auf dem man lebt, die Lunge herauszuschneiden.
»Verdammte Scheiße«, platzte es aus ihm heraus. »Was hätte ich auf dem Mars für einen einzigen Baum gegeben!«
Und dann dieser ganze Plastikmüll, von dem ein Teil zum Leidwesen aller Meeresbewohner früher oder später in den Ozeanen landete und auch fünfhundert Jahre später noch allgegenwärtig war.
Nach drei Stunden war sein Artikel endlich fertig. Das Ergebnis gehörte zwar nicht zu seinen Glanzleistungen, erschien ihm aber gut genug, um veröffentlicht zu werden. Außerdem lief ihm die Zeit ein wenig davon. Denn wie jeden Samstag hatte er sich mit seinen Kumpels zum Fußballspielen verabredet, einer Sportart, von der er vor seiner Zeit in München noch nie etwas gehört hatte.
3
Kurz darauf stand John vor seinem begehbaren Kleiderschrank und überlegte, was er anziehen sollte. Im Vergleich zu den Temperaturen in Malaysia war es schon fast kalt. Vielleicht fünfzehn Grad. Ihn fröstelte, wenn er nur daran dachte. Deshalb griff er intuitiv zu einer seiner langen Jogginghosen, auch wenn sich die anderen über ihn lustig machen würden. Sollen sie doch, dachte er sich. Hauptsache, ich friere nicht.
Und was sollte er obenrum anziehen? John strich mit den Fingern über eine Auswahl verschiedener Trikots, die seine Haushaltshilfe fein säuberlich aufgestapelt hatte. Am Ende blieben seine Finger bei einem Trikot seiner Lieblingsmannschaft aus Tottenham hängen.
Ja, das passt, dachte er und machte sich auf den Weg zum Bolzplatz. Es war einer dieser typischen kleinen Fußballplätze, die zum Schutz der umliegenden Häuser von Maschendraht umzäunt waren. Deshalb hatten John und die anderen irgendwann angefangen, den Bolzplatz Käfig zu nennen, obwohl sie es immer wieder schafften, den Ball über den Zaun hinwegzuschießen. An sich war das nicht weiter schlimm, wenn nicht bereits vier Fensterscheiben zu Lasten ihrer Mannschaftskasse in die Brüche gegangen wären.
Als John auf dem Bolzplatz eintraf, waren die anderen fünf Knastbrüder bereits dabei, sich warm zu machen. Sie alle waren aus der Nachbarschaft und Stammgäste in der Kneipe Brenners. Im Laufe der Zeit waren sie zu einer einge¬schworenen Gemeinschaft zusammengewachsen.
Den Namen Knastbrüder hatten sie Thomas zu verdanken. Er meinte, der Name würde gut zu ihnen passen, weil sie im Käfig wie Strafgefangene aussehen würden, die ihre tägliche Stunde Hofgang darauf verwendeten, Dampf beim Bolzen abzulassen.
Thomas musste es ja wissen. Schließlich war er der Einzige, der schon einmal eingesessen hatte. Angeblich war er einer der besten Hacker, den die Welt je gesehen hatte. Doch weder sah man ihm das eine noch das andere an. Er sah vielmehr wie ein erfolgreicher Manager aus, was vermutlich daran lag, dass er jetzt gegen gutes Geld vielen namhaften Konzernen erklärte, wie sie sich besser vor seines¬gleichen schützen konnten.
Überhaupt handelte es sich um eine illustre Runde, angefangen bei Nick Brenner, dem Inhaber des Brenners und ehemaligen Investmentbanker, über Benny, einen bekannten Steuerberater und eingefleischten Junggesellen, und Sergej und Pablo, die nicht nur zusammen eine große Werbeagentur betrieben, sondern auch privat ein Paar waren.
Auf das heutige Spiel freute John sich besonders, weil sie sich im Anschluss gemeinsam Bayern München gegen Borussia Dortmund ansehen wollten. Das Spiel des Jahres! Wenn Bayern heute nicht gewann, dann war die Meisterschaft für die Münchner wohl nicht mehr drin. John hätte nichts dagegen gehabt, denn sonst wäre es ja auch auf Dauer langweilig geworden. Es wäre jedenfalls mal eine Abwechslung, wenn am Ende der Saison eine andere Mannschaft oben stehen würde. Nicht immer die Bayern, wie in den letzten vier Jahren, seit er hier gelandet war.
Schnell wurden die Mannschaften zusammengestellt. Diesmal spielten Nick, Sergej und Thomas gegen John, Pablo und Benny. Nach den Trikots zu urteilen eine internationale Auswahl gegen den FC Bayern. Denn während Nicks Team als eingefleischte Bayernfans alle in Rot aufliefen, trug John ein Trikot der Spurs aus Tottenham, Benny ein Outfit der Königlichen aus Madrid und Pablo ein Shirt der alten Dame aus Turin.
»Kopf oder Zahl?«, fragte Benny, nachdem er den Ball auf den Mittelpunkt gelegt hatte und sich die Mannschaften um den Mittelkreis postiert hatten.
»Zahl«, antwortete Nick und schaute gespannt zu, wie Benny die Münze in die Luft schnippte und wieder auffing, bevor er sie mit der rechten auf den Handrücken seiner linken Hand legte.
»Kopf«, antwortete Benny. »Wir haben Anstoß. Und denkt daran, dass Treffer nur zählen, wenn der Torschütze im Fünf-Meter-Raum gestanden hat.«
»Und wie immer mit fliegendem Torwart«, gab Thomas ungeduldig zurück. Der Hinweis bezog sich auf das Spiel des Torwartes. Es handelte sich um eine Regel, die immer dann zur Anwendung kam, wenn sie nur zu sechst waren. Dadurch war es den beiden Torhütern möglich, in die Rolle eines Feldspielers zu wechseln, wenn ihr Team am Drücker war. So machte es einfach mehr Spaß. Nicht zuletzt, weil der Platz sonst zu groß gewesen wäre.
Dann ging es endlich los. Es ging hin und her und der Ball flitze übers Feld. John hatte gerade den Ball und passte zu Benny herüber, der sich rechts freigelaufen hatte. Er trieb den Ball voran und spielte in die Mitte, wo Pablo bereits auf der Lauer lag. Doch der Pass war zu ungenau, und der Ball landete bei Nick, der ihn sofort zu Sergej weiter spielte.
»Verdammt«, schrie Benny und machte auf dem Absatz kehrt, während Sergej mit der Kugel am Fuß auf John zudribbelte. Mit der besten Technik ausgestattet, täuschte Sergej rechts an und zog links vorbei. Nicht das erste Mal.
»Fuck«, brüllte John und ärgerte sich über sich selbst. Immer falle ich auf den gleichen Trick herein! Wie blöd muss man sein?
Sergej lachte, nahm den Kopf hoch und schlenzte den Ball lässig auf Thomas, der ihn an Benny vorbei ins Tor netzte.
»Eins zu null«, feixte Thomas und klatschte mit Sergej ab. Benny schimpfte wie ein Rohr¬spatz und beklagte sich darüber, dass Pablo immer noch an der Mittellinie herumlungerte. »Was treibst du da vorne?«, rief er. »Wir hätten dich hier hinten gut gebrauchen können.«
»Was beschwerst du dich?«, antwortete Pablo. »Spiel halt genauer, dann kommen wir erst gar nicht in die Situation.«
John hatte sich derweil den Ball geschnappt, fand aber keine Anspielstation, weil seine beiden Mitspieler immer noch miteinander diskutierten. »Hallo?!«, ermahnte er die beiden, während er Sergej bereits aus dem Augenwinkel auf sich zulaufen sah. Ausgerechnet Sergej!
Dann eben allein, dachte er und schoss den Ball schräg gegen den Maschendrahtzaun und damit an Sergej vorbei. Der Ball prallte von dort wieder ab und sprang ihm – wie erhofft – genau vor die Füße. Keine Sekunde zu spät, weil Thomas bereits im Begriff war, ihm den Ball zu klauen. Doch bevor Thomas den Ball mit der Picke erreichen konnte, spitzelte John ihm den Ball durch die Beine. Und – oh Wunder! – es klappte auch dieser Trick, auch wenn es vermutlich mehr Glück als Können gewesen war. Eine kurze Berührung, ein kurzer Kontakt – und schon war John an Thomas vorbei.
»Aua!«, schrie Thomas hinter ihm. »Das war Foul!« Doch John ließ sich davon nicht beirren und lief weiter. Er hatte jetzt nur noch Nick vor sich, der rückwärts auf sein eigenes Tor zulief.
Offensichtlich hatte Nick sich dazu entschieden, ihm als Torwart und nicht als Feldspieler gegenüberzutreten. Allerdings hörte er jetzt, dass jemand dicht hinter ihm war, ohne zu wissen, ob es sich um einen Mitspieler oder Gegner handelte. Mit dem Ball am Fuß rannte John auf das Tor zu. Nicht so eng, wie Sergej es vermochte, aber doch eng genug, um die Kontrolle zu behalten. Doch leider war er nicht schnell genug, denn Sergej war jetzt wieder neben ihm zu sehen und drängte ihn nach links ab. Es war also Sergej, den er hinter sich gehört hatte.
Was jetzt, fragte er sich. Sergej würde sich gleich den Ball schnappen. Dessen war er sich sicher. Spätestens wenn er sich in der Ecke festge¬dribbelt hatte. Sergej war einfach der viel bessere Fußballspieler, der das Kicken bereits mit drei und nicht, wie er, mit über dreißig gelernt hatte. Dann hatte er eine Idee! Er stoppte abrupt ab, trat auf den Ball und zog den rechten Fuß zusammen mit dem Ball nach hinten. Dann drehte er sich auf der Stelle um und sah zu, wie Sergej ein weiteres Mal ins Leere lief. Wow, dachte er und war von sich selbst überrascht.
Erst jetzt sah er Benny, der sich in der Mitte freigelaufen hatte und mit den Armen wedelte.
»Spiel ab«, schrie Benny. Und genau das tat John dann auch. Er nahm Maß und zirkelte den Ball direkt auf Bennys Fuß, der das Ding mit Vollspann unter die Latte nagelte. Nick hatte zwar noch versucht, den Ball abzu¬wehren, war aber letztendlich chancenlos.
Auf dem Weg zurück in die eigene Hälfte hob Benny den Daumen und bedankte sich bei John für die Vorarbeit. So wie er es immer tat, wenn ihm einer seiner Mitspieler ein Tor aufgelegt hatte. Pablo klatschte sogar Beifall und deutete eine Verbeugung an, als auch John wieder in der eigenen Hälfte angekommen war.
Doch lange währte seine Freude über die gelungene Einzelaktion nicht, weil just in dieser Sekunde eine Horde gelb und schwarz gekleideter Hooligans laut grölend am Käfig vorbeimarschierte.
Borussia-Fans! Auch das noch, dachte John. Geht einfach weiter! Bloß nicht anhalten. Doch diesen Gefallen tat ihm die Horde nicht, weil einer von ihnen die roten Trikots der Bayern durch den Maschendraht-zaun leuchten sah.
»Sieh mal einer an«, sagte ein Borusse mit der rauen Stimme eines Kettenrauchers und schippte seine Zigarette weg. »Drei Lederhosen. Denen machen wir mal unsere Aufwartung.«
Als John das hörte, war ihm sofort klar, dass es Ärger geben würde. Und richtig! Denn kaum dass die Horde den Käfig betreten hatte, zeigte der Typ mit dem Finger auf Nick, Sergej und Thomas und sagte: »Runter damit!« Zweifelsohne meinte er die Bayerntrikots, die die drei trugen.
»Wir wollen keinen Ärger«, sagte Nick. »Wir gehen einfach, okay?«
»Ausziehen!«, wiederholte die Reibeisenstimme seine Forderung, während einer seiner Kumpane demonstrativ die Tür versperrte.
»Kommt schon«, versuchte Benny zu beschwichtigen und machte einen Schritt auf den Wortführer zu. Ein Fehler, wie sich gleich herausstellte, weil der Kerl ohne Vorwarnung seine Faust ausfuhr. Der Schlag war hart und platziert und holte Benny direkt von den Beinen, noch bevor er einen Mucks von sich geben konnte. Er hatte den Schlag weder kommen sehen noch damit gerechnet.
»Bist du bescheuert?«, brüllte Nick. »Du Vollidiot hast ihm die Nase gebrochen.« Mehr brachte er nicht mehr heraus, weil er der Nächste war, der sich vor Schmerzen krümmend auf dem Boden wiederfand. Ein Schlag in den Solarplexus hatte gereicht. Er landete direkt neben Benny, der mittlerweile so stark aus der Nase blutete, dass sein Real-Madrid-Trikot eher an das der Bayern erinnerte.
Spätestens jetzt war sich John darüber im Klaren, dass er handeln musste, wenn er Schlimmeres verhindern wollte. Fieberhaft überlegte er, was er tun konnte, bis er die Kiste Bier sah, die Pablo mitgebracht hatte. »Bedient euch«, sagte er und schob die Kiste zwischen sich und die Angreifer.
Davon völlig überrascht, griffen die Hooligans tatsächlich zu und verschafften ihm die Zeit, die er brauchte, um die anderen aus dem Käfig zu bugsieren. »Los, raus hier!«, befahl er seinen Freunden. »Beeilt euch.«
Einer nach dem anderen verließ daraufhin mit hängenden Schultern den Platz. Zuletzt Benny, der kaum ohne Hilfe laufen konnte. Doch John folgte den anderen nicht, sondern machte die Tür von innen zu.
Nick starrte ihn mit großen Augen durch den Maschen¬drahtzaun an und konnte nicht glauben, was er da gerade sah. Das ist irre, dachte er. Nein, das ist reiner Selbstmord. Was soll das?
»Spinnst du? Komm da gefälligst raus!«, schrie er schließlich mit angstverzerrter Stimme.
Doch anstatt seiner Aufforderung zu folgen, presste John die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf.
»Watt soll dat denn werdn, wenns fettich is?«, fragte einer der kleineren Hooligans in einem Dialekt, wie er nur noch im tiefsten Ruhrgebiet gesprochen wurde. Er hatte die Situation als Erstes erkannt und seinen Nebenmann angerempelt. Beide lachten und kriegten sich kaum wieder ein.
»Das werdet ihr gleich sehen«, sagte John und drehte sich langsam zu ihnen um. Erst jetzt sah er sich die Meute etwas genauer an. Es war ein bunt gemischter Haufen. Einige waren noch blutjung, die meisten aber in seinem Alter oder älter. Und alle trugen gelbe Trikots und darüber Westen aus Jeansstoff, auf denen Gelbe Gefahr geschrieben stand. John wusste nicht, was es damit auf sich hatte, vermutete aber, dass es so etwas wie ihr Gang-Name war.
»Schluss jetzt mit die Fisimatenten«, blaffte ihn der Kettenraucher an und gab den anderen mit einer leichten Kopfbewegung zu verstehen, ihn einzukreisen. Er war ganz offensichtlich ihr Anführer, denn sie taten, wozu er sie aufforderte.
John hatte nicht verstanden, was er gesagt oder gemeint hatte. Er hatte aber auch nicht mehr richtig hingehört, so fokussiert und konzentriert wie er war. Seine Muskeln waren jetzt voll angespannt und warteten nur darauf zu explodieren.
Dann ging alles ganz schnell. Einer Raubkatze gleich, wirbelte John durch den Käfig und schlug dem Kettenraucher seine rechte Handkannte gegen den Hals. Röchelnd und nach Luft schnappend kippte er weg und rutschte den Maschendrahtzaun herunter, während John nach dem fülligen Typen trat, der neben ihm stand. Der Tritt war so heftig, dass der Kerl fünf Meter nach hinten flog und nicht mehr aufhörte zu jammern. Nur zu verständlich, denn John hatte dem Schwergewicht wenigstens drei Rippen gebrochen.
Gegner Nummer drei trat er zuerst zwischen die Beine, bevor er ihm sein Knie unter das Kinn jagte, das er ihm freiwillig entgegenreckte, als sich der Kerl vor Schmerzen krümmte. Das Geräusch war widerlich, so wie es eben klingt, wenn der Kiefer eines Mannes bricht.
Alles ging so schnell, dass Gegner Nummer vier noch gar nicht mitbekommen hatte, was ihm widerfuhr, bis er selbst an der Reihe war.
»Aah«, schrie er, nachdem John ihm beide Schneide-zähne ausgeschlagen hatte.
Im Gegensatz zu den restlichen Rabauken kam er aber noch einigermaßen glimpflich davon, weil die Wut in John erst jetzt so richtig tobte. Er rastete förmlich aus, ohne dass er sich den Kontrollverlust im Nachhinein erklären konnte. Vielleicht war es der Frust, weil er und seine Truppe bereits so lange ver¬geblich nach ihrem Zielobjekt gesucht hatten.
Am schlimmsten malträtierte John eine muskel¬be-packte Schrankwand, die mit einer Bierflasche auf ihn zustürmte und auch beinahe erwischt hätte, wenn Pablo ihn nicht gewarnt hätte.
»Pass auf«, schrie Pablo und sorgte so dafür, dass John dem Schlag gerade noch ausweichen konnte, bevor er selbst zur Flasche griff und dem Kerl damit einen Scheitel zog.
»Fuck!«, schrie Sergej, der aus nächster Nähe sah, wie ein Stück des linken Ohrs durch den Käfig segelte.
Das ganze Spektakel dauerte insgesamt nicht länger als drei Minuten. Gar nicht so schlecht, dachte John und schaute auf die Uhr. Er war zwar ein wenig einge¬rostet, aber immer noch schnell genug, um es mit einer Horde wie dieser aufzunehmen. Doch bevor er einen weiteren Gedanken formen konnte, spürte er Nicks ungläubigen Blick in seinem Rücken.
»Wer bist du?«, fragte er, als John sich umdrehte und ihre Blicke sich trafen.
4
Nick hatte das Brenners von seinem Vater geerbt und seitdem kaum verändert. Es war eines dieser typischen kleinen Wirtshäuser, in denen das Bier noch in Ma߬krügen ausgeschenkt wurde. Es gehörte zu den letzten seiner Art in ganz Schwabing, ja sogar in ganz München. Es war gemütlich und landestypisch eingerichtet. Mit vertäfelten Decken und Wänden, gedrechselten Stühlen und einem reich verzierten Tresen. Nur der Fernseher passte hier partout nicht hinein. Aber das war Nick egal. Dafür liebte er Fußball viel zu sehr. Außerdem brachte der große Flachbildschirm mehr Kunden in seinen Laden.
Er war sich sicher, dass sich die meisten seiner Kunden schon wieder abregen würden, nicht zuletzt weil er sich vorgenommen hatte, nächsten Samstag als Wiedergutmachung eine Lokalrunde zu schmeißen, wenn nötig auch zwei. Außerdem brauchte er erst einmal Zeit zum Nachdenken, zumal sie John später noch gemeinsam zur Rede stellen wollten.
»Journalist. Ich lach mich tot. So kämpft doch kein Journalist«, sagte er laut zu sich selbst, während er sich mit den Fingern durch seinen Vollbart fuhr. Er machte das häufig, wenn ihn etwas beschäftigte.
Der Bart war mittlerweile zu Nicks Marken¬zeichen geworden. Er hatte ihn wachsen lassen, als er seinen Job als Investmentbanker an den Nagel gehängt und die Wirtschaft seines Vaters übernommen hatte. Es war keine bewusste Entscheidung gewesen, sondern hatte sich ganz von allein ergeben.
Allmählich trafen auch die anderen Knastbrüder ein, die heute den Hintereingang nehmen mussten. Nur Benny fehlte, der aufgrund eines komplizierten Nasenbeinbruchs wohl noch mehrere Tage im Krankenhaus bleiben musste.
»Scheiße, was machen wir den jetzt?«, fragte Thomas in die Runde. »Ich bin noch auf Bewährung. Wenn die Polizei von der Sache Wind bekommt, dann fahr ich wieder ein. Ganz egal, wer angefangen hat. Glaubt mir, dann sind wir alle dran.«
»Ich glaube nicht, dass die Kerle zur Polizei gehen«, antwortete Nick. »Denn als wir losgerannt sind, habe ich noch mitbekommen, wie John ihnen gedroht hat, dass es noch viel schlimmer für sie kommt, wenn sie auch nur an die Polizei denken.«
»Was ist denn mit euch los?«, fragte Pablo, der immer noch ganz aufgekratzt wirkte. »Ich höre immer nur Polizei, Polizei. Seid ihr euch überhaupt darüber im Klaren, dass uns diese hirnamputierten Wichser vermutlich alle auf die Bretter geschickt hätten, wenn John nicht gewesen wäre?«
Anders als vorhin hatte Pablo sein langes schwarzes Haar jetzt zu einer Art Dutt drapiert, so wie er es häufig tat, wenn er einen auf Hipster machte.
»Ja, schon«, antwortete Sergej, der einen ganz anderen Typ verkörperte als sein Lebensgefährte. Er sah aus wie ein Buchhalter und war in ihrer Werbeagentur tatsächlich auch für die Finanzen zu-ständig.
»Aber das ist doch kein Grund, gleich so auszurasten! Stellt euch doch nur mal vor, wenn dabei jemand zu Tode gekommen wäre.«
»Alles Bullshit«, gab Pablo zurück. »Habt ihr nicht ge-sehen, dass John genau wusste, was er tat? Glaubt mir, so können nur Agenten oder Spezialeinsatzkräfte kämpfen.«
»Du guckst zu viel Fernsehen«, antwortete Nick. »Aber in einer Sache muss ich dir direkt recht geben. Jour¬na¬listen kämpfen bestimmt nicht so.«
Zur gleichen Zeit kniete John auf dem Boden und schrubbte sein 160 Quadratmeter großes Penthouse.
»Verdammter Mist«, fluchte er immer und immer wieder, während er gerade die Einbauten seines Bade-zimmers putzte. Alle anderen Räume hatte er bereits von seinen Fingerabdrücken und seiner DNA befreit. Genauso wie die wenigen Möbel, die in der Wohnung verteilt waren. Ein Bett, ein Schrank, ein paar Stühle, eine Einbauküche, eine Couch, ein Fernseher und eine Musik¬anlage. Das war’s. Insgesamt so wenig, dass man fast hätte meinen können, dass er erst gestern und nicht bereits vor über vier Jahren hier eingezogen war.
Zuvor war ihm klar geworden, dass die Knastbrüder die Sache nicht auf sich beruhen lassen würden. Er konnte zudem nicht ausschließen, dass die Borussen nicht doch noch zur Polizei gehen würden. Schließlich hatte er im Käfig ein Blutbad angerichtet.
Umso mehr ärgerte er sich, dass er es so weit hatte kommen lassen, obgleich er auch nicht wusste, was er anderes hätte tun können. Außer dabei zusehen, wie die Horde über seine Freunde herfiel. Denn ganz sicher wären die Schläger ihnen gefolgt, wenn er ebenfalls den Käfig verlassen hätte.
Eine Stunde später warteten die Knastbrüder immer noch auf ihn, verschwendeten aber keinen Gedanken daran, dass er nicht auftauchen würde. Er war schließlich ihr Freund und hatte ver¬sprochen, ihnen Rede und Antwort zu stehen.
Erst als er auch nach dem Abpfiff noch nicht aufge-taucht war, wurden sie langsam misstrauisch.
»Wo bleibt er denn?«, fragte Nick merklich angespannt und starrte zum wiederholten Male auf seine Uhr.
»Keine Ahnung«, antwortete Thomas und scharrte mit den Hufen. »Ich habe jedenfalls keine Lust mehr, hier ein¬fach nur rumzusitzen und abzuwarten.«
»Ja, ich auch nicht«, pflichte Pablo ihm bei, während er nicht aufhörte, am Zapfhahn herumzuspielen. Sie waren nach dem Spiel vom Stammtisch an den Tresen ge¬wech¬selt, hatten den Fernseher aber angelassen. Es lief gerade Alle Spiele, alle Tore.
»Jetzt hör mal damit auf«, ermahnte ihn Nick. »Du machst den Hahn noch kaputt.«
»Wir sollten nachschauen, ob er überhaupt zu Hause ist«, antwortete Pablo, ohne auf die letzte Einlassung von Nick zu reagieren.
»Ja, genau«, pflichte Nick ihm bei. »Wir haben lange genug gewartet.« Schon war er aufgesprungen und auf dem Weg zum Hintereingang.
Keine zehn Minuten später standen die Knastbrüder vor dem Haus und drückten abermals die Klingel, auf der seltsamerweise kein Name mehr stand.
»Wie oft sollen wir denn noch klingen?«, fragte Sergej. »Der Kerl ist nicht da.«
»Ich hab eine Idee«, sagte Nick. »Seine Nachbarin hat einen Schlüssel. Ich kenne sie ganz gut und denke, dass sie ihn mir gibt, wenn ich ihr erkläre, dass wir uns Sorgen um John machen.«
Tatsächlich hielten die Freunde zwei Minuten später den Schlüssel zu Johns Wohnung in der Hand.
»Das hat ja prima funktioniert«, sagte Sergej, während er Nick gespannt dabei beobachtete, wie er die Tür von Johns Penthouse aufschloss. Doch wie bereits erwartet, war er nicht zu Hause.
»Hier ist niemand«, sagte Nick und sprach damit nur das aus, was alle anderen dachten. »Selbst von seinem Hund ist nichts zu sehen. Sogar das Hundekörbchen ist weg.«
»Und das Teleskop«, fügte Pablo an und machte mit dem Kopf eine Bewegung in Richtung Terrasse.
»Ja«, antwortete Thomas, »und nicht nur das. Der Kerl ist ausgeflogen, abgehauen. Seht euch doch nur mal um, wie das hier aussieht. Alles ist so sauber! Sieht wie geleckt aus.«
John ließ München hinter sich. Er hatte die Wohnung vollständig geputzt, die wenigen Sachen einge¬steckt, die für ihn von Bedeutung waren, und sich schleunigst aus dem Staub gemacht. Er hatte sogar überlegt, Golan zurückzulassen, sich dann aber dagegen entschieden, obwohl er wusste, dass es ein Risiko war, sogar ein großes. Golan war ein Hund, der überall auffiel und Verfolger auf seine Spur führen konnte. Doch er hatte es nicht übers Herz gebracht, Golan zurückzulassen, der ihn mit seinen treuen Augen angeblickt hatte, als wüsste er, was sein Herrchen plante.
»Keine Angst«, hatte er schließlich gesagt. »Du kommst mit und dein Körbchen auch.«
John Herold, wie er sich in München genannt hatte, war nun Geschichte. Er existierte nicht mehr. Genauso wie sein Internetblog, den er bereits gelöscht hatte.
Noch mehr schmerzte ihn aber die Tatsache, dass er jeglichen Kontakt zu den Knastbrüdern abbrechen musste. Er hatte deshalb mit sich gehadert und überlegt, ob eine Flucht aus München wirklich notwendig war. Doch es gab keine Alternative! Anfangs hatte er sich noch eingeredet, alles erklären zu können, dann aber selbst einsehen müssen, dass alle Lügengeschichten, die er sich ausge¬dacht hatte, zu abenteuerlich und unglaubwürdig klangen. Außerdem ließ ihm das Protokoll keine Wahl. Es war in dieser Frage eindeutig und ließ ihm keinen Spielraum. Er hatte einen Fehler gemacht und musste jetzt dafür bezahlen. So einfach war das.
Er war mit Golan in seinen alten VW-Bulli gestiegen und Richtung Süden davongedüst. Er mochte den kleinen Bus, obwohl er sich erst daran hatte gewöhnen müssen, dass Autos mit allen vier Rädern auf dem Boden fuhren und nicht einfach auf Befehl abheben konnten.
Müde und erschöpft fiel John in den frühen Morgen-stun¬den ins Bett seiner Zuflucht, die er sich vor einigen Jahren für einen Fall wie diesen zugelegt hatte. Er war die ganze Nacht durch¬gefahren, bis er endlich in dem kleinen Haus in der Nähe von St. Gallen angekommen war. Und trotzdem war an Schlaf nicht zu denken. Dafür gingen ihm zu viele Dinge durch den Kopf.
Der vorherige Tag hatte mäßig angefangen und denkbar schlecht geendet. Er war leichtsinnig gewesen und hatte leichtfertig seine Tarnung aufs Spiel gesetzt und am Ende auch noch den wenigen Menschen den Rücken gekehrt, die ihm etwas bedeutet hatten.
Du Idiot, dachte John und wiederholte diese Worte in Gedanken wie ein Mantra. Irgendwann glitt er aber doch noch langsam in den Schlaf hinüber.
Wie so häufig träumte er vom Mars, seiner geliebten Heimat. Diesmal von seiner frühen Zeit bei den Mars-Defendern. Er war im Jahr 2529 einer von dreißig Rekruten gewesen, die das Glück hatten, einen Platz auf der Militärakademie in Redun, der größten Stadt auf dem Mars, zu ergattern. Da war er noch keine zwanzig Jahre alt gewesen.
Er und seine Kameraden wurden eine eingeschworene Gemeinschaft und unterstützten sich gegenseitig, wann und wo immer sie nur konnten. Das mussten sie auch, denn ihre Lehrer und Ausbilder trainierten sie hart und unerbittlich. Doch nach sechs Monaten hatte sich sein Heimweh fast verflüchtigt. Seine Kameraden auf der Militärakademie wurden zu seiner Familie, und er tat alles, um dem gnadenlosen Ausleseprozess nicht zum Opfer zu fallen.
Diese Sorge teilte er mit allen anderen Kameraden, und so schlossen sie eines Tages, nach einem dreitägigen Orientierungsmarsch in den Höhlensystemen nahe des Vulkans Arsia Mons, einen Pakt. Sie schworen, noch besser auf sich aufzupassen und dafür zu sorgen, dass keiner mehr die Akademie verlassen musste. Sie zogen und schleppten sich gegenseitig und feuerten sich an, wenn bei einem von ihnen die Kräfte nachließen. Ihr gegenseitiges Vertrauen wuchs von Tag zu Tag, und ehe sie sich versahen, wurden sie beste Freunde.
Im Unterschied zu ihrer Grundausbildung verrichteten sie ihren Dienst nicht nur in Redun, sondern auch in allen anderen drei großen Zentren. Redun war aber mit Abstand am größten. Das Stollen- und Höhlensystem war gigantisch und überwiegend natürlichen Ursprungs. Insgesamt gab es mehr als dreißigtausend Höhlen, die durch ein Netz von Stollen und Tunneln miteinander verbunden und einem mehrdimensionalen Spinnennetz sehr ähnlich waren. Einige der Höhlen waren mehrere Quadrat¬kilometer groß und mehr als hundert Meter hoch – und die Heimat von tausenden Marsianern. Insgesamt lebten in Redun, wenn man alle Höhlensiedlungen zusammenrechnete, mehr als 2,5 Millionen Einwohner.
Die Städte Aldar im Norden und Tiguan im Osten lernte er erst in seiner militärischen Ausbildung kennen. Dafür kannte er Golan, seine Heimatstadt, natürlich umso besser. Tiguan hatte ihm am wenigsten gefallen. Hier drehte sich alles um den Abbau von Gilizium, dem wichtigsten Rohstoff für den Bau der lebensnotwendigen Energiespeicher, ohne die ein Leben auf der Erde und dem Mars schon lange nicht mehr möglich war. Denn selbst die kleinsten Batterien aus Gilizium konnten eine unvorstellbare Menge an Energie speichern. Das Zeug war in seinem Ursprungszustand allerdings so fein, dass es sich überall festsetzte: in Nase, Mund, Augen und Ohren. Tiguan war einfach nur eine dreckige Stadt.
Aldar hatte er dagegen vom ersten Tag an gemocht. Das Klima in den Höhlen und Stollen war besonders. Es war hier ein wenig wärmer, und die Luft war salziger. Das lag an den riesigen Salzwasservorkommen, die sich vor Millionen von Jahren ihren Weg durch die Gesteins-schichten gebahnt hatten.
Seine größte Liebe galt aber bis heute Golan, seiner Heimat. Golan war die Kornkammer des Planeten. Hier wurde alles angebaut, was dank modernster Technik möglich war. In erster Linie Reis, Mais und Weizen, aber auch viele verschiedene Gemüsesorten. Aber leider nie genug, um autonomes Leben auf dem Mars zu ermöglichen. Deshalb mussten die meisten Lebensmittel von der Erde eingeflogen werden. So verging kaum eine Woche, in der sich nicht wenigstens ein Raumschiff auf die 39 Tage dauernde Reise begab.
In seinem Traum sah John auch die Marsoberfläche, die er im letzten Jahr seiner Offiziersausbildung besser und besser ken¬nen¬gelernt hatte. Er war zu diesem Zeitpunkt für die Überwachung der riesigen Windparks verantwortlich, die auf dem gesamten Mars wie Pilze aus dem Boden schossen und genug Energie lieferten, um den Mars in eine riesige Glühlampe zu verwandeln. Dafür bekam er sogar seinen eigenen Gleiter und lernte so den gesamten Planeten kennen, wie nur wenige vor ihm. Auch Sektoren, die er noch gar nicht kannte, hatte er aus seinem Gleiter heraus bestaunt.
Besonders beeindruckend fand er die gewaltigen Flutkanäle am Rande der nördlichen Tiefebenen. Sie waren einige dutzend Kilometer breit und ein paar hundert Kilometer lang und einstmals mit Wasser gefüllt. Und dann waren da noch die vulkanischen Regionen Tharsis und Elysium mit seinen zwei gewaltigen Beulen in der Marskruste. Olympus Mons, der größere der beiden Vulkane, hatte an seiner Basis einen Durchmesser von sechshundert Kilometern und erhob sich 24 Kilometer Meter über seine Umgebung. Wie so häufig sah sich John im Traum an einer der Flanken steil emporschießen. Immer höher und höher.
John lächelte im Schlaf, wie immer, wenn er seinen Heimatplaneten im Traum besuchte.
Anno 2538
5
5
Als Präsident Carter nach einer elfstündigen Marathonsitzung der Vereinten Nationen an das Rednerpult trat, um eine Abschlusserklärung abzugeben, konnte man die Spannung in der Luft des großen Plenarsaals förmlich knistern hören. Alle Augen waren jetzt auf ihn gerichtet, als er gemächlichen Schrittes über den weißen Mar¬mor¬fu߬boden schritt. Seine Körperhaltung war mustergültig. Lässig und doch irgendwie würdevoll, so wie sein ganzes Erscheinungsbild. Angefangen bei seinem blauen schnörkel¬losen Anzug, einer Maßanfertigung, die man ihm auf seinen asketischen Leib geschneidert hatte, bis hin zu seiner grauen Kurzhaarfrisur, die perfekt ge-scheitelt war.
Am Rednerpult angekommen, straffte er seine knochigen Schultern, richtete das Mikrofon und legte seine Hände seitlich an das Rednerpult. Es gehörte zu seinen vielen Ritualen, die er sich angeeignet hatte, um seine Nervosität zu bekämpfen. Eine Nervosität, die er trotz all seiner Erfahrung nie ganz ablegen konnte, obwohl er bald siebzig wurde und dieses kräfte-zehrende Amt jetzt schon seit mehr als zwölf Jahren innehatte. Dem Namen nach hätte man meinen können, dass er Engländer oder Amerikaner war. Doch er war weder das eine noch das andere. Er war Schweizer mit französischen Wurzeln.
Anschließend blickte er mit müden Augen lange die steil aufsteigenden Reihen empor und suchte nach den richtigen Worten.
»Ladys und Gentlemen«, begann er seine Rede, »als unsere Vorväter vor mehr als einhundert Jahren die Kolonie auf dem Mars gründeten, waren sie fest davon überzeugt gewesen, dass autonomes Leben auf dem Mars möglich sei. Nicht wenige haben sogar geglaubt, dass die gesamte Menschheit eines Tages dorthin übersiedeln würde. Insbesondere wenn der Klimawandel weiter fortschreiten und ein Leben auf der Erde immer schwieriger oder sogar unmöglich sein würde.«
Carter war jetzt in seinem Element. Die Nervosität war wie weggeblasen, und ohne auch nur ein einziges Mal auf seine Notizen zu blicken, redete er weiter: »Doch leider müssen wir akzeptieren, dass dieser Plan nicht aufge¬gangen ist. Das Gegenteil ist sogar der Fall, weil aus dieser Vision längst eine Belastung geworden ist, die wir nicht mehr länger schultern können. Der Mars hat sich wie ein Mühlstein um unseren Hals gelegt und droht, uns in die Tiefe zu ziehen. Es ist deshalb an der Zeit, dass wir den Tatsachen ins Auge blicken und endlich akzeptieren, dass das größte Projekt in der Geschichte der Menschheit gescheitert ist. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, den Mars mit allem zu versorgen, was er selbst nicht hervorbringen kann. Damit muss jetzt Schluss sein. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass wir früher oder später selbst daran zugrunde gehen. Deshalb werde ich morgen den Antrag stellen, die Marskolonie aufzulösen und unsere Leute nach Hause zu holen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende«, brachte es Carter auf den Punkt.
Die 1098 Parlamentarier der weltweiten Staaten¬ge-meinschaft waren angesichts der klaren Worte wie vom Donner gerührt. Es herrschte eine beinahe beängstigende Stille, bevor es laut wurde und alle durcheinanderredeten. Während die eine Hälfte applau-dierte und jubelte, war die andere Hälfte offen¬sichtlich ganz anderer Meinung.
Davon unbeeindruckt, zog Carter seinen sechshundert¬fünfzig Jahre alten Colt und schoss in Richtung Decke. Augenblicklich wurde es wieder still.
Der Colt, der ursprünglich US-General Custer gehört hatte, war natürlich nur mit Platzpatronen geladen. Er wurde von Präsident zu Präsident seit mehr als zweihundert Jahren als Zeichen der Autorität weitergegeben und zuletzt von Juan Rivalto abgefeuert, nachdem sich das Parlament darüber zerstritten hatte, welche Aufgaben iHumans in der Staatengemeinschaft wahrnehmen dürfen und welche nicht. Heute war die Frage obsolet, weil iHumans mittlerweile in nahezu allen Funktionen und Hierarchie¬ebenen eingesetzt wurden. Genau genommen war ein Leben ohne iHumans schon lange nicht mehr vorstellbar. Viele von ihnen waren sogar eigens für Aufgaben entwickelt worden, die Menschen nicht übernehmen wollten oder konnten. Sei es für den Außeneinsatz in der Landwirtschaft oder für den Bau der riesigen Biosphären, die mittlerweile den halben Planeten überzogen. Und mit Sicherheit wären sie auch die besseren Soldaten und Polizisten gewesen, wenn es nicht ein Gesetz gegeben hätte, das iHumans das Tragen von Waffen strikt unter¬sagt hätte.
Auch äußerlich unterschieden sich iHumans kaum von Menschen, zumindest wenn man die K- und T-Serie als Maßstab nahm. Sie gehörten der neuesten Generation an und sahen nicht nur so aus wie Menschen, sondern verhielten sich auch so. Das einzige verlässliche Unterscheidungsmerkmal waren ihre Finger, denn im Unterschied zu echten Menschen hatten iHumans keine Fingernägel.
Nachdem sich das Plenum wieder beruhigt hatte, meldeten sich einige Abgeordnete überraschend zu Wort. Carter erkannte dies an den kleinen Lämpchen, die hier und da an den Sitzreihen aufleuchteten und zu blinken anfingen. Ungewöhnlich und auch ungebührlich, weil der Präsident normalerweise das letzte Wort hatte. Deshalb ignorierte er derartige Versuche in der Regel auch.
Doch heute wollte er sie zu Wort kommen lassen, vor allem weil Abel Friedmann, der Leiter der Mars-Evolution, zu denjenigen zählte, die ein elektronisches Handzeichen abgesetzt hatten. Carter nickte ihm zu und gab der Regie den Befehl, seinen Kanal zu öffnen. Daraufhin nahm sein holografisches Antlitz in der Mitte des Raums langsam Gestalt an, bis man selbst die kleinsten Konturen seines Gesichts erkennen konnte. So konnten Carter und alle anderen Parlamentarier nicht nur hören, sondern auch besser sehen, was Friedmann zu sagen hatte. Die holografische Übertragung war nötig, weil der Bumerang, wie der Plenarsaal wegen seiner Form genannt wurde, zu groß war, als dass jeder hätte jeden sehen können.
Aber auch Friedmann konnte jetzt besser sehen, weil sein eierschalen¬förmiger Sitz zeitgleich weit über die Brüstung geschoben wurde, sodass man leicht den Eindruck gewinnen konnte, dass er augenblicklich über den Rand hinabstürzen würde. Doch das schien nur so, weil sein Sessel, wie alle anderen auch, unterwärts mit einem Teleskoparm verbunden war.
Alle Blicke waren jetzt auf den alten kahlköpfigen Mann gerichtet. Denn sein Wort hatte Gewicht.
»Sehr geehrte Damen und Herren«, fing Friedmann an zu reden, »ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal zu Ihnen sagen würde, aber der Präsident hat recht. Unsere Mission ist gescheitert. Wir müssen endlich aufhören, uns weiter selbst zu belügen, und aufhören, uns gegenseitig etwas vorzu¬machen.«
Die Worte gingen dem Leiter der Mars-Evolution offenbar nur schwer über die Lippen, zumal er damit auch seine persönliche Niederlage einräumte. Carter erkannte dies an den Tränen, die Sternschuppen gleich von seinem Hologramm aus auf den Boden zu tropfen schienen.
»Aber wenn es uns doch noch gelingt, ein stabiles Magnetfeld zu etablieren?«, schrie einer der Parlamentarier aus Afrika lautstark dazwischen.
»Keine Chance«, antwortete Abel Friedmann. »Uns fehlt einfach das Wissen und die Technologie. Außerdem haben wir gar nicht die Mittel, um einfach so weiterzumachen. Wir haben bereits eine gigantische Summe investiert und sind immer noch zu weit von einer Lösung unserer Probleme entfernt. Das ist die nackte Wahrheit, die wir endlich akzeptieren sollten«, beendete Friedmann seinen Kommentar.
Der Appell schien zu fruchten, weil die Zahl derer, die gerade noch die Entscheidung von Präsident Carter kritisiert hatten, mit einem Mal um mehr als ein Drittel geschrumpft war. Eigentlich nicht weiter überraschend, weil es im Grunde seit zwanzig Jahren ein offenes Geheimnis war, dass das künstliche Magnetfeld um den Mars herum nie richtig funktioniert hatte – trotz aller Unsummen, die die Staatengemeinschaft Jahr für Jahr und Jahrzehnt für Jahrzehnt bereitgestellt hatte. Es war unmöglich, den Mars vor der kosmischen Strahlung zu schützen. Was viel¬versprechend begonnen hatte, hatte sich zunehmend als Illusion herausgestellt, weil es nie gelungen war, die dünne Suppe über den Köpfen der Marsianer in eine erdähnliche Atmosphäre zu verwandeln.
Zuletzt war ein Vertreter aus Lateinamerika an der Reihe. Carter kannte ihn nicht, konnte aber seinen Namen auf seinem Display ablesen. Zudem erschien sein Hologramm wieder hoch über ihren Köpfen.
»Herr Präsident«, sagte der braungebrannte Kolum-bianer, »ich teile ihre Auffassung zu einhundert Prozent. Ich frage mich nur, wie es jetzt weitergeht. Unsere Zeit auf der Erde läuft ab. Das ist leider genauso sicher. Wir können uns doch nicht in unser Schicksal ergeben und einfach abwarten, bis sich die Erde ebenfalls in einen lebensfeindlichen Planeten verwandelt hat.«
Als ob jemand einen Knopf gedrückt hätte, wurde es augenblicklich wieder lauter, bis es Vizepräsident Gardner zu bunt wurde.
»Ladys und Gentlemen, bitte bewahren Sie Ruhe«, ermahnte er die Parlamentarier. »Es bringt uns nicht weiter, wenn wir alle durcheinanderreden. Reißen Sie sich jetzt verdammt noch einmal zusammen!«
»Genau darum geht es doch«, entgegnete Carter und nahm damit den Faden wieder auf, nachdem sich die Gemüter wieder ein wenig beruhigt hatten. »Wir müssen endlich aufhören, ein totes Pferd zu reiten, und stattdessen anfangen, alle Kraft und Mittel in jene Projekte zu investieren, die helfen, unser Überleben wirksam zu sichern. Ich denke dabei insbesondere an die Projekte zur Revitalisierung des Klimas, denen wir mangels der notwendigen Mittel zuletzt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben.«
Anschließend beendete der Präsident die Sitzung, aber nicht ohne die Parlamentarier noch ein weiteres Mal zu überraschen.
»Eines sollten Sie noch wissen«, sagte er, machte eine Redepause und schaute betont gelassen in die Runde. »Ich werde morgen meine Carte blanche ausspielen.«
Ein Raunen ging daraufhin durch den Saal. Damit hatte keiner gerechnet. Zwar war es nicht so, dass noch kein Präsident während seiner Amtszeit von dieser einmaligen Möglichkeit Gebrauch gemacht hatte, nur war das schon sehr lange her.
Danach stand Carter auf, blickte in die Runde und verließ den Bumerang. Die meisten der 1098 Parlamentarier taten es ihm gleich und begaben sich zu den Ausgängen, während sich 66 weitere Abgeordnete im wahrsten Sinne des Wortes einfach in Luft auflösten. Streng genommen waren es natürlich nur ihre Hologramme, die sie wie Geister hatten aussehen lassen, bevor die Regie die Übertragung beendet hatte. Schuld waren die Stürme über dem indischen Ozean, die aktuell einfach zu unberechenbar waren und es diesen Parlamentariern unmöglich gemacht hatten, persönlich an der Sitzung teilzunehmen. Dafür waren selbst in Höhen von mehr als zwölf Kilometern die Windgeschwindigkeiten von über 180 Stundenkilometern einfach zu stark.
Am Rednerpult angekommen, straffte er seine knochigen Schultern, richtete das Mikrofon und legte seine Hände seitlich an das Rednerpult. Es gehörte zu seinen vielen Ritualen, die er sich angeeignet hatte, um seine Nervosität zu bekämpfen. Eine Nervosität, die er trotz all seiner Erfahrung nie ganz ablegen konnte, obwohl er bald siebzig wurde und dieses kräfte-zehrende Amt jetzt schon seit mehr als zwölf Jahren innehatte. Dem Namen nach hätte man meinen können, dass er Engländer oder Amerikaner war. Doch er war weder das eine noch das andere. Er war Schweizer mit französischen Wurzeln.
Anschließend blickte er mit müden Augen lange die steil aufsteigenden Reihen empor und suchte nach den richtigen Worten.
»Ladys und Gentlemen«, begann er seine Rede, »als unsere Vorväter vor mehr als einhundert Jahren die Kolonie auf dem Mars gründeten, waren sie fest davon überzeugt gewesen, dass autonomes Leben auf dem Mars möglich sei. Nicht wenige haben sogar geglaubt, dass die gesamte Menschheit eines Tages dorthin übersiedeln würde. Insbesondere wenn der Klimawandel weiter fortschreiten und ein Leben auf der Erde immer schwieriger oder sogar unmöglich sein würde.«
Carter war jetzt in seinem Element. Die Nervosität war wie weggeblasen, und ohne auch nur ein einziges Mal auf seine Notizen zu blicken, redete er weiter: »Doch leider müssen wir akzeptieren, dass dieser Plan nicht aufge¬gangen ist. Das Gegenteil ist sogar der Fall, weil aus dieser Vision längst eine Belastung geworden ist, die wir nicht mehr länger schultern können. Der Mars hat sich wie ein Mühlstein um unseren Hals gelegt und droht, uns in die Tiefe zu ziehen. Es ist deshalb an der Zeit, dass wir den Tatsachen ins Auge blicken und endlich akzeptieren, dass das größte Projekt in der Geschichte der Menschheit gescheitert ist. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, den Mars mit allem zu versorgen, was er selbst nicht hervorbringen kann. Damit muss jetzt Schluss sein. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass wir früher oder später selbst daran zugrunde gehen. Deshalb werde ich morgen den Antrag stellen, die Marskolonie aufzulösen und unsere Leute nach Hause zu holen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende«, brachte es Carter auf den Punkt.
Die 1098 Parlamentarier der weltweiten Staaten¬ge-meinschaft waren angesichts der klaren Worte wie vom Donner gerührt. Es herrschte eine beinahe beängstigende Stille, bevor es laut wurde und alle durcheinanderredeten. Während die eine Hälfte applau-dierte und jubelte, war die andere Hälfte offen¬sichtlich ganz anderer Meinung.
Davon unbeeindruckt, zog Carter seinen sechshundert¬fünfzig Jahre alten Colt und schoss in Richtung Decke. Augenblicklich wurde es wieder still.
Der Colt, der ursprünglich US-General Custer gehört hatte, war natürlich nur mit Platzpatronen geladen. Er wurde von Präsident zu Präsident seit mehr als zweihundert Jahren als Zeichen der Autorität weitergegeben und zuletzt von Juan Rivalto abgefeuert, nachdem sich das Parlament darüber zerstritten hatte, welche Aufgaben iHumans in der Staatengemeinschaft wahrnehmen dürfen und welche nicht. Heute war die Frage obsolet, weil iHumans mittlerweile in nahezu allen Funktionen und Hierarchie¬ebenen eingesetzt wurden. Genau genommen war ein Leben ohne iHumans schon lange nicht mehr vorstellbar. Viele von ihnen waren sogar eigens für Aufgaben entwickelt worden, die Menschen nicht übernehmen wollten oder konnten. Sei es für den Außeneinsatz in der Landwirtschaft oder für den Bau der riesigen Biosphären, die mittlerweile den halben Planeten überzogen. Und mit Sicherheit wären sie auch die besseren Soldaten und Polizisten gewesen, wenn es nicht ein Gesetz gegeben hätte, das iHumans das Tragen von Waffen strikt unter¬sagt hätte.
Auch äußerlich unterschieden sich iHumans kaum von Menschen, zumindest wenn man die K- und T-Serie als Maßstab nahm. Sie gehörten der neuesten Generation an und sahen nicht nur so aus wie Menschen, sondern verhielten sich auch so. Das einzige verlässliche Unterscheidungsmerkmal waren ihre Finger, denn im Unterschied zu echten Menschen hatten iHumans keine Fingernägel.
Nachdem sich das Plenum wieder beruhigt hatte, meldeten sich einige Abgeordnete überraschend zu Wort. Carter erkannte dies an den kleinen Lämpchen, die hier und da an den Sitzreihen aufleuchteten und zu blinken anfingen. Ungewöhnlich und auch ungebührlich, weil der Präsident normalerweise das letzte Wort hatte. Deshalb ignorierte er derartige Versuche in der Regel auch.
Doch heute wollte er sie zu Wort kommen lassen, vor allem weil Abel Friedmann, der Leiter der Mars-Evolution, zu denjenigen zählte, die ein elektronisches Handzeichen abgesetzt hatten. Carter nickte ihm zu und gab der Regie den Befehl, seinen Kanal zu öffnen. Daraufhin nahm sein holografisches Antlitz in der Mitte des Raums langsam Gestalt an, bis man selbst die kleinsten Konturen seines Gesichts erkennen konnte. So konnten Carter und alle anderen Parlamentarier nicht nur hören, sondern auch besser sehen, was Friedmann zu sagen hatte. Die holografische Übertragung war nötig, weil der Bumerang, wie der Plenarsaal wegen seiner Form genannt wurde, zu groß war, als dass jeder hätte jeden sehen können.
Aber auch Friedmann konnte jetzt besser sehen, weil sein eierschalen¬förmiger Sitz zeitgleich weit über die Brüstung geschoben wurde, sodass man leicht den Eindruck gewinnen konnte, dass er augenblicklich über den Rand hinabstürzen würde. Doch das schien nur so, weil sein Sessel, wie alle anderen auch, unterwärts mit einem Teleskoparm verbunden war.
Alle Blicke waren jetzt auf den alten kahlköpfigen Mann gerichtet. Denn sein Wort hatte Gewicht.
»Sehr geehrte Damen und Herren«, fing Friedmann an zu reden, »ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal zu Ihnen sagen würde, aber der Präsident hat recht. Unsere Mission ist gescheitert. Wir müssen endlich aufhören, uns weiter selbst zu belügen, und aufhören, uns gegenseitig etwas vorzu¬machen.«
Die Worte gingen dem Leiter der Mars-Evolution offenbar nur schwer über die Lippen, zumal er damit auch seine persönliche Niederlage einräumte. Carter erkannte dies an den Tränen, die Sternschuppen gleich von seinem Hologramm aus auf den Boden zu tropfen schienen.
»Aber wenn es uns doch noch gelingt, ein stabiles Magnetfeld zu etablieren?«, schrie einer der Parlamentarier aus Afrika lautstark dazwischen.
»Keine Chance«, antwortete Abel Friedmann. »Uns fehlt einfach das Wissen und die Technologie. Außerdem haben wir gar nicht die Mittel, um einfach so weiterzumachen. Wir haben bereits eine gigantische Summe investiert und sind immer noch zu weit von einer Lösung unserer Probleme entfernt. Das ist die nackte Wahrheit, die wir endlich akzeptieren sollten«, beendete Friedmann seinen Kommentar.
Der Appell schien zu fruchten, weil die Zahl derer, die gerade noch die Entscheidung von Präsident Carter kritisiert hatten, mit einem Mal um mehr als ein Drittel geschrumpft war. Eigentlich nicht weiter überraschend, weil es im Grunde seit zwanzig Jahren ein offenes Geheimnis war, dass das künstliche Magnetfeld um den Mars herum nie richtig funktioniert hatte – trotz aller Unsummen, die die Staatengemeinschaft Jahr für Jahr und Jahrzehnt für Jahrzehnt bereitgestellt hatte. Es war unmöglich, den Mars vor der kosmischen Strahlung zu schützen. Was viel¬versprechend begonnen hatte, hatte sich zunehmend als Illusion herausgestellt, weil es nie gelungen war, die dünne Suppe über den Köpfen der Marsianer in eine erdähnliche Atmosphäre zu verwandeln.
Zuletzt war ein Vertreter aus Lateinamerika an der Reihe. Carter kannte ihn nicht, konnte aber seinen Namen auf seinem Display ablesen. Zudem erschien sein Hologramm wieder hoch über ihren Köpfen.
»Herr Präsident«, sagte der braungebrannte Kolum-bianer, »ich teile ihre Auffassung zu einhundert Prozent. Ich frage mich nur, wie es jetzt weitergeht. Unsere Zeit auf der Erde läuft ab. Das ist leider genauso sicher. Wir können uns doch nicht in unser Schicksal ergeben und einfach abwarten, bis sich die Erde ebenfalls in einen lebensfeindlichen Planeten verwandelt hat.«
Als ob jemand einen Knopf gedrückt hätte, wurde es augenblicklich wieder lauter, bis es Vizepräsident Gardner zu bunt wurde.
»Ladys und Gentlemen, bitte bewahren Sie Ruhe«, ermahnte er die Parlamentarier. »Es bringt uns nicht weiter, wenn wir alle durcheinanderreden. Reißen Sie sich jetzt verdammt noch einmal zusammen!«
»Genau darum geht es doch«, entgegnete Carter und nahm damit den Faden wieder auf, nachdem sich die Gemüter wieder ein wenig beruhigt hatten. »Wir müssen endlich aufhören, ein totes Pferd zu reiten, und stattdessen anfangen, alle Kraft und Mittel in jene Projekte zu investieren, die helfen, unser Überleben wirksam zu sichern. Ich denke dabei insbesondere an die Projekte zur Revitalisierung des Klimas, denen wir mangels der notwendigen Mittel zuletzt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben.«
Anschließend beendete der Präsident die Sitzung, aber nicht ohne die Parlamentarier noch ein weiteres Mal zu überraschen.
»Eines sollten Sie noch wissen«, sagte er, machte eine Redepause und schaute betont gelassen in die Runde. »Ich werde morgen meine Carte blanche ausspielen.«
Ein Raunen ging daraufhin durch den Saal. Damit hatte keiner gerechnet. Zwar war es nicht so, dass noch kein Präsident während seiner Amtszeit von dieser einmaligen Möglichkeit Gebrauch gemacht hatte, nur war das schon sehr lange her.
Danach stand Carter auf, blickte in die Runde und verließ den Bumerang. Die meisten der 1098 Parlamentarier taten es ihm gleich und begaben sich zu den Ausgängen, während sich 66 weitere Abgeordnete im wahrsten Sinne des Wortes einfach in Luft auflösten. Streng genommen waren es natürlich nur ihre Hologramme, die sie wie Geister hatten aussehen lassen, bevor die Regie die Übertragung beendet hatte. Schuld waren die Stürme über dem indischen Ozean, die aktuell einfach zu unberechenbar waren und es diesen Parlamentariern unmöglich gemacht hatten, persönlich an der Sitzung teilzunehmen. Dafür waren selbst in Höhen von mehr als zwölf Kilometern die Windgeschwindigkeiten von über 180 Stundenkilometern einfach zu stark.
Copyright © Alle Rechte vorbehalten.